Seit langer Zeit mal wieder ein Beitrag: eine Kritik von Norbert Häring zu einem Artikel von Jens Berger in den „Nachdenkseiten“, zum Thema „Zinskritik“. Jens Berger hatte diesen Artikel 2011, vor 12 Jahren, veröffentlicht, und es ging damals darum, eine von den sog. Zinskritikern vorgebrachte „Fundamentalkritik“ an der Erhebung von Zins zu entkräften.
Um es also vorweg kurz zusammenzufassen: Was ist gemeint mit Zinskritik?
Jens Berger sagt dazu:
Der Zins, so liest man auf einigen Internetseiten, sei der Konstruktionsfehler, ja geradezu die „Erbsünde“ unseres Geld- und Finanzsystems. Er sorge nicht nur dafür, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, sondern führe auch ganz direkt zu einem exponentiellen Wachstumszwang der Geldmenge und zur Zinsknechtschaft der Bevölkerung. Finanz- und Wirtschaftskrisen seien somit die direkte Folge des Zinssystems.
Die Kritik würde als Konsequenz also beinhalten, das Geldsystem so zu verändern, dass Zinsen auf Null reduziert, also „abgeschafft“ werden, aus oben genannten Gründen. Berger will dagegen seine Sicht darlegen, dass Zinsen eine durchaus sinnvolle Funktion im Wirtschaftsverkehr erfüllen. Zu kritisieren wäre nur eine zu ungleiche Verteilung der Vermögen, und damit, indirekt bzw. daraus resultierend, eine zu ungleiche Verteilung der Macht der Vermögenden:
Diese Kritik war und ist jedoch meist keine ökonomische Kritik, sondern vielmehr eine Kritik an der ungleichen Verteilung des Vermögens und der Macht der Vermögenden, oft durchmischt mit einem religiösen, völkischen, ja antisemitischen Grundton.
Im Folgenden setzt er sich mit den „Irrtümern der Zinskritiker“ auseinander, deren Argumente, wie er zeigen will, „bei näherer Betrachtung wie ein Kartenhaus in sich zusammen“ fallen.
Ein starkes Argument gegen diese Zinskritik ergibt sich, wie Berger zeigt, daraus, dass eine behauptete Folge dieser „Erbsünde“ der Erhebung von Zinsen gar nicht auf den Zins als solchen zurückzuführen ist. Die Zinskritiker behaupten, eine Umverteilung von unten nach oben und die damit verbundene Vermögenskonzentration sei ursächlich dem Zins zuzuschreiben. Tatsächlich liegen die Ursachen für Veränderungen der Vermögensverteilung aber ganz woanders, wie in der Periode zwischen 1945 und 1980 zu beobachten war:
Eine kausale Erklärung für diese korrekt beobachtete Entwicklung liefern die Zinskritiker jedoch nicht. Empirisch lässt sich der Zusammenhang von Zins und Vermögenskonzentration jedoch relativ einfach widerlegen, wenn man sich die Periode von 1945 bis 1980 anschaut. Diese Periode wird auch als „große Kompression“ bezeichnet und zeichnete sich dadurch aus, dass sich nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensschere in allen westlichen Industrieländern immer weiter geschlossen hat. Während dieser Periode hat sich jedoch kaum etwas am Geld- oder Zinssystem verändert.
Was hat sich aber tatsächlich geändert bzw. wodurch wurde diese Veränderung bewirkt:
Was diese Periode auszeichnete, war vielmehr ein klares Bekenntnis seitens der Politik, mittels Gesetzen und des Steuersystems für eine Angleichung der Lebensverhältnisse zu sorgen.
Wie Berger völlig richtig analysiert, war es der ab den 1980er Jahren immer mehr Einfluss und Dominanz gewinnende Neoliberalismus, die dann wieder zu einem Aufspreizen der Vermögensschwere geführt hat.
Erst die neoliberale Politik, die von Reagan und Thatcher in den 80ern eingeführt und in den Folgejahren von fast allen westlichen Industrieländern kopiert wurde, führte zum Ende der „großen Kompression“ und zur erneuten Öffnung der Einkommens- und Vermögensschere. Am Geld- und Zinssystem hat sich jedoch seit Beginn der neoliberalen Ära ebenfalls relativ wenig verändert. Der Zins war immer da, die Einkommens- und Vermögensentwicklungen, die zur heutigen Konzentration am oberen Ende geführt haben, sind eine direkte Folge der neoliberalen Politik – vor allem der Steuerpolitik.
Berger ist absolut darin zuzustimmen, dass Überlegungen zu einer möglicherweise alternativen Konstruktion des Zinssystems oder gar dessen Abschaffung völlig überflüssig sind, weil sie sich – mit ein wenig gesundem Menschenverstand – ganz von selbst ergeben:
Wer sich einmal die Entwicklung des Spitzensteuersatzes in den Vereinigten Staaten vor Auge führt, findet die Erklärung, warum sich die Einkommens- und Vermögensschere seit 1980 öffnet, von ganz allein. Um diese Entwicklung zu analysieren, braucht man keine Zinskritik – es reicht der gesunde Menschenverstand.
Trotz der hohen Spitzensteuern in den Kriegs- und Nachkriegsjahren konnten die Einkommen auch in den unteren Schichten gesteigert werden, die Ungleichheit nahm also ab, und die soziale Sicherheit, Bildungsqualität und Gesundheitsstandards konnten erhöht bzw. verbessert werden. Das Zinsniveau hatte darauf keinen Einfluss.
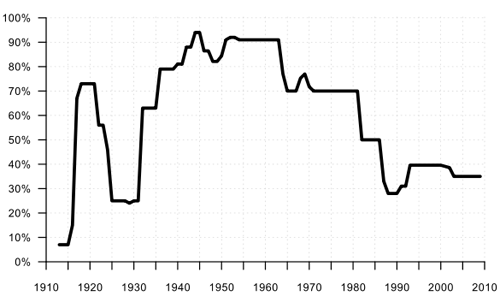
Abbildung: Spitzensteuersatz in den USA – Quelle: Wikimedia Commons
Norbert Häring: Zinskritik ist kein Denkfehler
Nun zur Kritik Norbert Härings. Häring stimmt Berger insoweit zu, dass man Zinsen nicht – mit Gewinn für die Allgemeinheit – einfach abschaffen oder verbieten kann. Dies ist auch leicht einzusehen: wer glaubt, (zu) hohe Zinsen seien ein „Systemfehler“ wie auch etwa (zu) hohe Kosten des Lebensunterhalts oder zu hohe Löhne oder umgekehrt zu hohe Gewinne, der irrt: jeder wünscht sich natürlich aus seiner Sicht niedrige Kosten, hohe Löhne und niedrige Zinsen, aber dem steht natürlich der Wunsch nach hohen Einkommen und etwa hohen Standards in Bildung und Gesundheit entgegen, die natürlich auch erwirtschaftet und bezahlt werden müssen.
Die Kritik Härings an der „Zinskritik“ Bergers geht aber nun in die Richtung, dass nicht die Zinskritik zu kritisieren sei, sondern – der Kapitalismus. Häring meint:
Wichtig zu erwähnen wäre aber auch, dass der Zins ein Mittel ist, um im Sinne des kapitalistischen Systems zu steuern, wer bevorzugt auf gesamtwirtschaftliche Ressourcen zugreifen darf, um „Investitionen vorzunehmen und die eigene Ertragssituation zu steigern“.
Da taucht also plötzlich jemand auf am Steuer, den Berger gar nicht auf der Rechnung hatte: nämlich das kapitalistische System, das bei Entscheidungen über Investitionen und gesamtwirtschaftliche Ressouren ein Wort mitzureden hat. Berger geht zumindest implizit oder in seinem Text sicher auch davon aus, dass dies alles, das Auf und Ab von Zinsen, Einkommen und Gewinnen, sich im kapitalistischen System abspielt, aber das ist nicht extra zu erwähnen, denn: zum kapitalistischen System gibt es – bisher – noch keine bekannte, erprobte und durchführbare Alternative.
Norbert Häring will aber nun behaupten, es gäbe eine oder gar mehrere Alternativen:
Es gibt andere Möglichkeiten der Zuteilung. Stellen wir uns zum Beispiel eine Konsumgenossenschaft vor, die einen Betrieb gründet, um die Produkte herzustellen, die die Mitglieder der Konsumgenossenschaft haben wollen. Die Konsumenten strecken dem Produzenten die nötigen Betriebsmittel vor, damit er für sie gemäß Vereinbarung Waren produziert.
Oder stellen wir uns ein vergesellschaftetes Kreditsystem vor, in dem Kredite nach gesellschaftlichen Kriterien vergeben werden. Der Zins muss dann vielleicht dafür sorgen, dass die Kreditgeber keine Verluste machen, aber er wäre idealerweise nicht das Hauptzuteilungsinstrument.
Das soll vor allem deutlich machen, dass es ganz andere Sichtweisen gibt, wenn man die Prämissen des kapitalistischen Systems verlässt.
Also: Konsumgenossenschaften, oder vergesellschaftete Kreditsysteme. Häring stellt allerdings gleich klar, dass es so einfach wohl nicht ist mit den Alternativen, jedenfalls muss er für das an dieser Stelle, in diesem Text argumentativ zu beackernde Feld schonmal gleich passen:
Das Pro und Kontra der skizzierten Alternativen ist ein zu weites Feld, um es hier zu beackern.
Aber Häring hat ja in seinem ganzen Buch über „Das Ende des Kapitalismus“ Argumente zusammengetragen, die darum sicher nicht in diesem Text neu beackert werden müssten. Dennoch finden sich in Härings ganzem Buch aber letztlich kaum Argumente, die über die hier von Häring genannten hinausgehen: Kapitalismus ohne Zins könne tatsächlich kaum funktionieren, wie er sagt, es sei denn – man „erweitert den Rahmen“ und lässt „andere Wirtschaftsmodelle“ zu:
Ja, viele der Argumente der Zinskritiker überzeugen nicht, wenn diese versuchen, sie systemimmanent vorzutragen. Kapitalismus ohne Zins kann tatsächlich kaum funktionieren. Aber wenn man den Rahmen erweitert und andere Wirtschaftsmodelle zulässt, kann man sehr gut zu dem Ergebnis kommen, dass solche ohne Zins vorzuziehen wären.
Wirtschaftsmodelle, die ohne oder mit sehr niedrigem Zins auskommen, sind Elemente einer Zurückdrängung des Kapitalismus. Ein Zinsverbot als Allheilmittel wäre dagegen eine unrealistische Wunschvorstellung. Mit einem Federstrich lässt sich der Kapitalismus nicht abschaffen.
Härings Lösung wären also: Elemente der Zurückdrängung des Kapitalismus, und andere Wirtschaftsmodelle. Ja aber: warum gibt es diese Elemente und Modelle denn (noch immer) nicht, und warum ist der Kapitalismus denn (noch immer) nicht am Ende? Sondern läuft, im Gefolge von Coronakrise und Ukraine-Krieg, zu vollkommen irrwitzigen, bis dahin nie geahnten Höhen auf?
Elemente der Abschaffung des Kapitalismus?
Solche Elemente zu Zurückdrängung des Kapitalismus hat es gegeben, und sie waren den Vordenkern der ökonomischen Wissenschaft ja nicht unbekannt. Meist denkt man an die drei bekannten Schöpfer der „Grand Theories“, Marx, Keynes und Schumpeter, wenn es um Elemente der Zurückdrängung des Kapitalismus geht, wobei man Marx meist keine in dem Sinne guten Absichten unterstellt, dass so ein Zurückdrängen erstens im Rahmen demokratisch legitimierter Mittel und Wege sich bewegen würde, und zweitens, dass es von Erfolg gekrönt sein würde, in der Art, dass Menschen in aller Welt dies für wünschenswert und attraktiv halten würden. Die Marxsche „Diktatur des Proletariats“ würde niemand für ein probates Element zur Zurückdrängung des Kapitalismus halten.
Joseph Schumpeter und John Maynard Keynes sahen das aber anders. Vor allem waren die beiden sich, trotz erheblicher Unterschiede in ihren Ansätzen, darin einig, dass es weniger um ein Zurückdrängen des Kapitalismus würde gehen müssen, sondern: der Kapitalismus würde das gewissermaßen von selbst erledigen. Der Kapitalismus würde seinen Job erledigen, er würde reifen, nachdem er seine Blütejahre mit hohen Wachstumsraten, hohen Unternehmensgewinnen, ebenfalls hohen Zinsen und hohen Wohlstandsgewinnen in Form hoher und sicherer Löhne erreicht haben würde.
Beide Ökonomen rechneten ab Mitte bis Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre mit einem Einbrechen des expansiven Wachstums. Das würde bedeuten: der Kapitalismus und die in und mit ihm lebenden Menschen könnten sich nun gewissermaßen auf den Lorbeeren ausruhen, und ihren Lebensinhalt anders definieren und gestalten, als durch die weitere ständige „innovative“ Erfindung neuer Konsumgüter, die das Leben NOCH luxuriöser, aufregender, bedeutender und beneidenswerter gestalten sollen.
Das wären dann in der Tat wirksame Elemente der Abschaffung des Kapitalismus gewesen, wobei, und das ist keine Nebenbemerkung, der Kapitalismus eben nicht würde „abgeschafft“ werden müssen, sondern er wäre am seinem eigentlichen Ziel angekommen, er hätte den anvisierten Erfolg der Wohlstandsmaximierung eingefahren, und stünde nun vor anderen Zielen, Inhalten und Aufgaben.
Nur: wie wäre dieses Ziel der Schaffung eines stabilen, statischen, „resilienten“ und nicht mehr wachstumsabhängigen Wohlstands zu erreichen gewesen? Keynes glaubte, dies sei in erster Linie durch die Verkürzung der Arbeitszeit zu erreichen, und auch allgemein durch eine Erweiterung der Rolle des öffentlichen Sektors. Am Kapitalismus mit seiner zentralen Rolle des Privateigentums wollte Keynes aber nichts ändern.
Anders Joseph Schumpeter. Schumpeter glaubte, das Ende der produktiven, schöpferischen Phase des Kapitalismus werde, wie bei Keynes, den Erfolg dieser produktiven Phase bedeuten, aber dann – werde man quasi in einem ganz undramatischen einfachen Verwaltungsakt den „Sozialismus“ einläuten. Niemand werde etwas dagegen haben, niemand werde das befürchten und kritisieren, oder gar bekämpfen. Die Zeit werde einfach reif sein für den Sozialismus, und der werde im Wesentlichen darin bestehen, dass die öffentliche Hand nun das Ruder übernimmt. Die Aufgaben der Wirtschaft, Produktion und Verteilung, werden dann ganz andere sein, wenn die Aufgabe der Innovation und der Schaffung immer größeren Wohlstands erreicht sein werde, und ab dann werde es um Erhaltung des Geschaffenen, und die eher bürokratische Verwaltung des öffentlichen Vermögens gehen.
Elemente der Abschaffung des Kapitalismus – in China?
China gilt für Viele nicht unbedingt als leuchtendes Vorbild, sondern eher, noch immer, als Diktatur. Aber all die Übel, die Norbert Häring in diesem Artikel und auch in seinen Büchern über das herbeizuführende Ende des Kapitalismus nennt, also exponentieller Wachstumszwang, Zinsknechtschaft, Vermögenskonzentration, Oligarchie und Herrschaft des privaten Geldes, gibt es in China immerhin nicht. Zwar gibt es in China einen obersten Staatschef auf Lebenszeit, und das sieht für Viele sehr nach Diktatur aus. Aber, wie die Erfahrungen vieler Besucher des Landes der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen, geht es den Menschen doch recht gut in diesem Land, das sich nach langem Kampf aus der Armut befreit hat.
Es gibt auch privates Eigentum, und das ist in einigen Fällen riesig groß. Aber die Macht im Staate hat das private Eigentum nicht. Und das Vermögen des Staates ist so groß, dass niemand in der Lage wäre, hier die Machtverhältnisse so umzudrehen, wie es in den westlichen Oligarchien der Fall ist.
Joseph Schump1eter hat zwar auch erwartet oder gehofft, so ein simpler Verwaltungsakt werde mit einem Schlag, an einem einzigen Tag den Sozialismus Wirklichkeit werden lassen, aber das werde, wie gesagt, nur die formale Besiegelung von lange geschehenen Entwicklungen sein, die von der Wirklichkeit und den Menschen längst bestätigt sind.
Auf dem Wege dahin, glaubte auch Schump1eter, werde es eine schrittweise Veränderung geben, so dass die Rolle und die Wirkungsmacht und -tiefe des öffentlichen Sektors nach und nach, schrittweise zunehmen werde.
So hätte man in diesen Jahren, als das Wehklagen über das Einbrechen des Wachstums, der Gewinne und Beschäftigung einsetzte, den öffentlichen Sektor ausweiten, die schrittweise die Arbeitszeit verkürzen, und eine Reihe von Unternehmen, die zwar nicht mehr wachstumsfähig, aber erhaltenswert waren, verstaatlichen können. So hatte Joseph Schumpeter dies für einige Unternehmen vorgesehen, wie er am Beispiel der Entwicklung in England einmal aufgezeigt hat.
Aber was passierte dann? Der Neoliberalismus machte sich breit. Und was hatte das zur Folge: es gab dann zwar weiteres Wachstum, aber nicht mehr Wohlstandszuwachs für alle, für die Masse der Menschen, sondern nur noch Gewinnzuwachs für Unternehmen bzw. deren Eigner. Und diese Vermögen landeten in zunehmendem Maße in immer den gleichen Händen: bei den Vermögensverwalten, den Jongleuren von „OPM“, von other peoples money.
Und so ist es bis heute geblieben, und die Menschen träumen seit 40 Jahren von neuen Innovationen und neuem Wachstum, das einen „Aufschwung“ beschert und einen neuen „Wums“, wie der kleine Träumer Bubi Scholz diese Fata Morgana genannt hat, als er dann Bundeskanzler werden durfte.
Warum muss es nun Wachstum geben – Keynes und Schumpeter sahen keinen Wachstumszwang. Das Schlüsselelement, das Keynes und Schumpter sahen, war der hinreichend große, wirkungsvolle, aktive, gut mit aktiven und gebildeten Menschen ausgestattete öffentliche Sektor, was für Schumpeter „Sozialismus“ bedeutete.
Wachstumszwang nur noch für die Vermögen der Reichen
Wachstum muss es eigentlich nur geben, damit die konzentrierten Vermögen der Vermögensbesitzer wachsen können – in alle Ewigkeit.
Patrick Kaczmarczyk, ein junger hoffnungsvoller Ökonom, hat seinem letzten Buch „Kampf der Nationen“ beschrieben, warum es Wachstum geben muss:
Warum müssen Firmen wachsen? Wenn wir uns der Unternehmensanalyse zuwenden, so müssen wir selbstverständlich andere Kriterien anlegen, als wir es bei der Bewertung der wirtschaftlichen Leistung eines Staates tun. Wie es allerdings in der Politik üblich ist, dass die vielleicht am meisten debattierte Frage die Frage nach dem Wachstum ist (ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, lassen wir mal stehen), so haben auch die Unternehmen vornehmlich das Ziel »Wachstum« im Kopf. Warum? Die Antwort darauf ist einfach: Wie wir als Menschen sehen sich Firmen ebenfalls einer völlig ungewissen Zukunft gegenüber. Und so, wie wir Menschen mit der Ungewissheit unsere Schwierigkeit haben oder sie gerne verdrängen, mögen Firmen den Umstand genauso wenig.
In der produktiven Phase des Kapitalismus war es so, dass diese Arena des Kampfes ums Überleben und – natürlich – auch um Wachstum von Gewinnen, Anteilen und Branchen einen Zwang bedeuteten. Völlig richtig, so war es (und ist es für einige noch immer) mit dem Wachstumszwang und den Unternehmen in einer völlig ungewissen Zukunft. Eben darum, weil diese Zeit des Kampfes um Innovationen und immer neue aufregende, die Menschen entzückende Produkte lange vorbei ist, wie der Ökonom Robert Gordon in seinem Buch über „Aufstieg und Fall des (amerikanischen) Wachstums“ so schön gezeigt hat, müssen die ehemaligen Großunternehmen die Rolle übernehmen, die in der Blütezeit des Kapitalismus die privaten Unternehmen und die „Schumpeterschen“ innovativen, schöpferischen Unternehmer innehatten.
Heute müssen öffentliche Unternehmen, der öffentliche Sektor diese Rolle übernehmen – eben weil sie nicht mehr wachsen müssen, und auch keiner ungewissen Zukunft mehr gegenüberstehen. Sie müssen, wie früher auch die Bundesbahn, solide, verlässlich und umsichtig arbeiten und wirtschaften, wie es die Schweizer Bahnen bis heute tun, die privatisierte deutsche Bahn aber leider nicht mehr, weshalb die Schweizer Bahn die deutschen Züge nicht mehr ins Land lässt, weil die Deutschen zu unzuverlässig geworden sind.
Null-Grenzkosten-Gesellschaft – resiliente Gesellschaft – aktiver öffentlicher Sektor
Wir brauchen also keine neuen Elemente der Abschaffung des Kapitalismus, sondern eine Erweiterung des öffentlichen Sektors, und zwar in angemessenem und hinreichendem Umfang. Der Wahn des Neoliberalismus gaukelt den Menschen seit mindestens 40 Jahren vor, dass nur private, gewinnorientierte Initiative und die Anreize durch hohe Managereinkommen wieder einen neuen Boom und Verhältnisse wie zu Wirtschaftswunderzeiten einkehren lassen. Aber das ist absurd.
Was es bedeutet und wohin es führen kann, wenn der öffentliche Sektor, ja die ganze Politik und die ehemalige „vierte Gewalt“, die Medien, völlig kapitulieren vor der Habgier der privaten Gewinnsucht, zeigen die inzwischen gewonnenen Erfahrungen mit der „Pandemie“. Ein kürzlich erschienener Beitrag des ÖR Fernsehens im SWR2 zeigt auf, wie hemmungslos mit dem Geld der Steuer- und Beitragszahler umgegangen worden ist. Mit (teilweise falschen) Test-Centern, Soforthilfen, Masken-Beschaffung, Apotheker-Deals und vor Allem den verschleuderten Milliarden für die Pharmamindustrie sind die Menschen systematisch und in großem Stil betrogen worden.
Diese Entwicklungen, die vor inzwischen über 40 Jahren auf die falsche Bahn gelotst worden sind, sind nicht leicht wieder zurückzudrehen. Was heute verstanden werden muss: Was sinnvolle Elemente einer Eindämmung des Kapitalismus sein können, ist eigentlich längst bekannt, es wurde aber – mit sehr unfeinen, betrügerischen – Mitteln verhindert. Heute muss dieser ungeheuerliche Betrug aufgedeckt werden, die Menschen müssen endlich aufwachen und sich dem entgegenstellen – und dann die Wege einschlagen, die sie vor gut 40 Jahren schon hätten einschlagen können.
Wirklicher Reichtum, sagte Karl Marx immer wieder, ist nicht Geld-Reichtum, und er trägt keine Zinsen, und wirft keine Zinsen ab. Wirkliches Vermögen und wirklicher Reichtum ist öffentliches Vermögen, und nicht in Geld zu bewerten und mit Geld oder Gold aufzuwiegen. Menschen müssen verstehen, dass der öffentliche Reichtum geschaffen und gewonnen werden muss – solange es noch geht.
