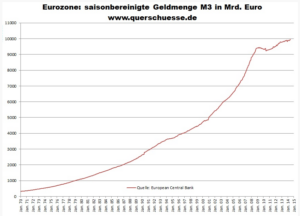Heiner Flassbeck wirft der Linken (der Partei) und den Linken (als Strömung) vor, sie wisse nicht, wo sie hin will: will sie das System (den Kapitalismus) verändern, oder will sie ihn überwinden? Und das, diese Unentschlossenheit und Unklarheit habe äusserst fatale Konsequenzen: „Es gelingt dem gesamten konservativen Block einschließlich der AfD, den Eindruck zu erwecken, dass die einzig linke Partei von „linken Spinnern“ durchdrungen ist, die nichts Besseres im Sinn haben, als das „System“ zu überwinden und durch ein Nirwana zu ersetzen, das ungefähr so erfolgreich ist wie die ehemalige DDR.“ Und darum werden nicht sie gewählt, sondern etwa auch, neuerdings, die Afd. „Mit dieser Strategie wird man die Linke noch hundert Jahre bei zehn Prozent halten können. Wenn die Partei nicht begreift, dass die Träume von einem anderen System, das niemand kennt und niemand der großen Mehrheit der Bürger erklären kann, in der Politik nur Schaden anrichten. Denn die große Mehrheit will kein anderes System. Und sie hat damit vollkommen Recht.“
Ist das so? richtig ist, das ein „anderes“ System niemand kennt – wie alles, das eines Tages ganz frisch und neugeboren die Bühne betritt. Aber heisst das, das neue System liegt im Nirwana? und ist so erfolgreich wie die ehemalige DDR?
Was ist denn falsch am Kapitalismus, warum könnte man sich seine Überwindung wünschen? Wünschbar wäre eine Alternative aus vielerlei Gründen, die man durchaus klar benennen kann, und die z. B. Jürgen Habermas vor vielen Jahren als den Konflikt zwischen System und Lebenswelt bezeichnet hat. Der Kapitalismus steuert sich im wesentlichen durch das Medium Geld, nicht durch demokratische, vernunftgeleitete Diskurse. Das ist ein Mangel – allerdings keiner von dem man sagen könnte wie er denn nachhaltig zu beheben sei. Also führt diese Argumentation nur zur Möglichkeit der Zähmung, Kultivierung und politischen Kontrolle – so weit wie möglich.
Aber heisst das, der Kapitalismus lebt ewig? Einer der großen Verteidiger und Bewunderer des Kapitalismus, Joseph Schumpeter, hat bekanntlich die Frage, ob der Kapitalismus weiterleben kann, eindeutig beantwortet: „Nein, meines Erachtens nicht“.
Aber die Gründe, die Schumpeter genannt hat, waren im wesentlichen nicht die, die heute genannt werden, um eine „Überwindung“ des Kapitalismus zu begründen. Schumpeter glaubte, der Kapitalismus habe eines Tages seine geschichtliche Aufgabenstellung erfüllt. Die Aufgabenstellung bestand darin, die Bedürfnisse der Massen zu befriedigen, eines nach dem anderen. Die Menschen sollten nicht mehr unter Not und Mangel leiden wie noch im Feudalismus, wo über 70 Prozent der Bevölkerung auf den Feldern arbeiten mussten, nur um das tägliche Brot zu erwirtschaften, wo ein Buch ein Luxusgegenstand war, und die Kleider, die jemand im Schrank hatte, zu seinem Vermögen gezählt wurden.