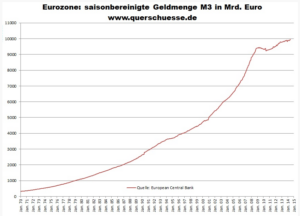In seinem Handelsblatt Morning-Briefing vom 30.01. schildert Gabor Steingart die haarsträubenden Hintergründe dieser neuesten Dimension des VW-Abgasskandals, des „Diesel-Gates“. VW hat an Tier- und zeitweilig sogar an Menschenversuchen die Gefährlichkeit der Abgasbelastung von Dieselabgasen testen lassen. Dem Dieseluntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages lagen Berichte darüber vor, und dem ist es egal. Albrecht Müller von den Nachdenkseiten teilt Steingarts Empörung: „Der Herausgeber des Handelsblatts hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Er nennt die Tests der Abgasbelastung an Affen und die damit einhergehende Kommentierung bzw. Ignoranz bei Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und Politikern eine Elitenverwahrlosung.“
In seinem Handelsblatt Morning-Briefing vom 30.01. schildert Gabor Steingart die haarsträubenden Hintergründe dieser neuesten Dimension des VW-Abgasskandals, des „Diesel-Gates“. VW hat an Tier- und zeitweilig sogar an Menschenversuchen die Gefährlichkeit der Abgasbelastung von Dieselabgasen testen lassen. Dem Dieseluntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages lagen Berichte darüber vor, und dem ist es egal. Albrecht Müller von den Nachdenkseiten teilt Steingarts Empörung: „Der Herausgeber des Handelsblatts hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Er nennt die Tests der Abgasbelastung an Affen und die damit einhergehende Kommentierung bzw. Ignoranz bei Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und Politikern eine Elitenverwahrlosung.“
Vor einigen Jahren erschien Steingarts Buch mit dem schönen Titel „Bastardökonomie“, das sein Verlag mit folgenden Worten ankündigt: „Nach der Krise ist vor der Krise. Vor einem staunenden Publikum türmen sich die Milliarden zu Billionen: Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Kaum jemand kann noch verstehen, was mit unserer Wirtschaft los ist. Es geht uns gut, aber wir sind besorgt. Wir exportieren fleißig, aber die Verschuldung steigt. Wir helfen in Südeuropa, doch die Lage spitzt sich weiter zu. Wir tanzen in den Tempeln des Konsums und wissen längst, dass es so nicht weitergehen kann.“
Was ist mit unserer Wirtschaft, und was ist mit unseren Eliten los?
Was ist mit unserer Wirtschaft los – wir überschütten uns gegenseitig mit den Erzeugnissen unserer fleissig arbeitenden Ökonomien, und hoffen sie losschlagen zu können. Grosse Empörung löste die Idee Donald Trumps aus, die amerikanische Wirtschaft abschotten zu wollen, damit sich nicht Elendsbilder wie verfallende Stadtteile und Hochhäuser in Detriot, oder Zeltstädte in Los Angeles in Amerika ausbreiten. Das ist Protektionismus! Amerika soll doch einfach selber bessere Autos bauen. Dann sieht man die Elendsbilder woanders.
US-Konzerne, denen es nicht so schlecht geht, lagern ihr Geld lieber im Ausland, wie zum Beispiel Apple. Apples Geldreserven betrugen Ende September 268,9 Milliarden Dollar. Davon lagerten 94 Prozent außerhalb der USA, schrieb der FOCUS im Januar. Man muss ihnen großzügige Steuergeschenke machen, um sie dazu zu bewegen, doch wenigstens einen Teil dieses Geldes dem „Homeland“, den eigenen notleidenden Landsleuten zur Verfügung stellen, statt es weiter vollkommen ungenutzt aus Offshore-Konten liegen zu lassen. Was ist mit unseren Eliten los?
„Elitenverwahrlosung, Nullzinsen und die neue Sicherheitsstrategie“ weiterlesen
 Das Programm des Kultursenders ARTE, in dem man lange Zeit echte informative Hintergrunddokumentationen vorfinden konnte, die im Programm von ARD und ZDF entweder in tiefste Nachtstunden oder ganz in den Orkus verbannt worden waren, hat sich nun offenbar auch der Dämonisierung Russlands, mit Vorliebe in der Person Putins, verschrieben. Nach den
Das Programm des Kultursenders ARTE, in dem man lange Zeit echte informative Hintergrunddokumentationen vorfinden konnte, die im Programm von ARD und ZDF entweder in tiefste Nachtstunden oder ganz in den Orkus verbannt worden waren, hat sich nun offenbar auch der Dämonisierung Russlands, mit Vorliebe in der Person Putins, verschrieben. Nach den